Zivilreligion
Mit seinem Aufsatz "Civil Religion in America" eröffnete
der amerikanische Soziologe Robert N. Bellah 1967 eine grosse Debatte
unter Soziologen, Religionswissenschaftlern, Politologen und Theologen
über den Beitrag der Religion zum Zusammenhalt moderner Gesellschaften.
Die Debatte kreist um drei Hauptfragen:
- ob und inwiefern Religion notwendig ist, um den Zusammenhalt einer
Gesellschaft zu garantieren (nach der These von Emile Durkheim,
1912) bzw. ob die Grundwerte einer Gesellschaft religiös begründet
und vermittelt sein müssen, um allgemein anerkannt zu werden
- inwiefern die traditionellen Religionen (in Europa und Amerika:
katholisches und protestantisches Christentum sowie Judentum) diese
Rolle im modernen demokratischen Staat überhaupt wahrnehmen,
nachdem erstens Grund- und Menschenrechte zwar auch in der
biblischen Tradition vorkommen,
zweitens aber gerade die Kirchen (besonders die römisch-katholische)
die Moderne bis Mitte des 20. Jahrhunderts erbittert bekämpften und
drittens die kirchliche Bindung der Menschen (zumindest in
Westeuropa) in den letzten Jahrzehnten stark zurück gegangen ist
- inwiefern die bereits 1762 von Jean-Jacques Rousseau im seinem
Hauptwerk "Du contrat social" geforderte
"religion civile" die traditionellen Religionen in
dieser Rolle ablösen kann oder soll und ob es dafür seither
praktische Beispiele gibt
Rousseau
"Die Dogmen der bürgerlichen Religion müssen einfach, gering an Zahl und klar ausgedrückt
sein, ohne Erklärungen und Erläuterungen. Die Existenz der allmächtigen, allwissenden, wohltätigen,
vorhersehenden und sorgenden Gottheit, das zukünftige Leben, das Glück der Gerechten und die
Bestrafung der Bösen sowie die Heiligkeit des Gesellschaftsvertrags und der Gesetze -
das sind die positiven Dogmen. Was die negativen Dogmen anbelangt, so beschränke ich sie auf
ein einziges: die Intoleranz."
(J. J. Rousseau, Gesellschaftsvertrag, 1762, Buch IV, Kap. VIII, zit. nach Guizzardi,
Der Theismus mit öffentlichen Funktionen, S. 85).
"Nun ist es für den Staat ja sehr wohl wichtig, daß jeder Bürger eine Religion hat, die
ihn seine Pflichten lieben heißt; aber die Dogmen dieser Religion interessieren den Staat
und seine Glieder nur insoweit, als sie sich auf die Moral beziehen und auf die Pflichten, die
derjenige, der sich zu ihr bekennt, gegenüber den anderen zu erfüllen gehalten ist. Darüber hinaus
mag jeder Anschauungen hegen, wie es ihm gefällt, ohne daß dem Souverän eine Kenntnis
davon zustünde. Denn in der anderen Welt besitzt er keinerlei Befugnis, und es ist nicht seine
Sache, welche das Los der Untertanen in
einem künftigen Leben sei, vorausgesetzt, daß sie in diesem hier gute Bürger sind."
(J.J. Rousseau, a.a.O.; zit nach Guizzardi, a.a.O., S. 85f.)
"Die Zivilreligion Rousseaus sieht nun folgendermaßen aus: »ein rein bürgerliches
Glaubensbekenntnis, dessen Artikel festzusetzen dem Souverän zukommt, nicht eigentlich als
Dogmen einer Religion, sondern als Gesinnung des Miteinander, ohne die es unmöglich ist,
ein guter Bürger und ein treuer Untertan zu sein.«"
(J.J. Rousseau, a.a.O.; zit nach Guizzardi a.a.O, S. 87)
Jean-Paul Willaime:
Zivilreligion nach französischem Muster
"Die französische Zivilreligion ist zwar eine laizistische, aber
dennoch ist es ihr nicht gelungen, jeden religiösen Bezug aus dem
von ihr in Anspruch genommenenn Imaginären auszutilgen.
...
Ausgehend vom französischen Beispiel kann man sich in der Tat fragen,
ob nicht jede demokratische Gesellschaft darauf angewiesen sei, einen
religiösen Bezug in ihren Horizont aufzunehmen, um so, auch wenn sie
dabei durchaus laizistisch bleibt, ihre Ordnung in einem jenseits
von ihr Liegenden zu fundieren und so zu garantieren, daß
sich das Soziale nicht in sich selbst einschließt.
Eignet sich der Staat eine Religion an, so wird er totalitär und
intolerant: das Frankreich nach der Aufhebung des Ediktes von Nantes,
welche
unter Louis XIV die Protestanten aus Frankreich vertrieb, und das
Frankreich des revolutionären Terrors, welches seinerseits die der
Zivilverfassung der Kleriker sich widersetzenden katholischen Priester
vertrieb und die Klöster aufhob, sind zwei Beispiele für die totalitäre
Gewalt, der ein Staat unterliegt, sobald er sich als Vertreter einer
Religion ausgibt.
(Jean-Paul Willaime, Zivilreligion nach französischem Muster, S. 166)
Zivilreligion in der Schweiz: die "Geistige Landesverteidigung"
Unter dem Begriff Geistige Landesverteidigung versteht man den mit
geistigen Mitteln geführten Abwehrkampf der Schweiz gegen die Ideologie des deutschen
Nationalsozialismus
und des italienischen Faschismus in der Zeit vor und während dem 2. Weltkrieg.
Die Geistige Landesverteidigung betonte
gegenüber dem ausgeprägten Nationalismus der Faschisten, deren erklärtes Ziel
die Vereinigung aller "Volksgenossen" in Großdeutschland bzw.
Italien war, die Eigenständigkeit der Schweiz und den
Wert ihrer kulturellen Vielfalt als Europa en miniature.
Die Geistige Landesverteidigung war allerdings weder eine staatlich gelenkte
Aktion noch eine private Organisation. Vielmehr geht es um eine fast unüberschaubare
Vielzahl von einzelnen Gruppen und Aktionen, die - bei aller Einigkeit gegenüber
dem Faschismus - sowohl von ihrer weltanschaulichen Herkunft als auch von ihren
Strategien gegenüber dem äusseren Feind her alles andere als eine einheitliche
Haltung vertraten. Das macht das Phänomen Geistige Landesverteidigung
schillernd und schwer fassbar.
Die Geistige Landesverteidigung hatte unübersehbar auch eine
zivilreligiöse Komponente:
- Der Besuch der Landesausstellung ("Landi") 1939 in Zürich
wurde zur Pilgerfahrt, die im "Höhenweg" gipfelte:
Die Männer nahmen ergriffen
und ehrfüchtig ihre Hüte ab wie in einer Kirche. Vor der Statue
"Wehrbereitschaft" legten die BesucherInnen Blumen und
Münzen nieder und drückten damit ihre Opferbereitschaft aus.
(Isabelle Meier, Mythos Landi, p. 79)
- Selbst ein zivilreligiöses Credo [Glaubensbekenntnis] wurde formuliert
und im Bundesblatt veröffentlicht:
«Der schweizerische Staatsgedanke ist nicht aus der Rasse, nicht aus dem
Fleisch, er ist aus dem Geist geboren. Es ist doch etwas Grossartiges, etwas
Monumentales, dass um den Gotthard, den Berg der Scheidung und den Pass
der Verbindung, eine gewaltig grosse Idee ihre Menschwerdung, ihre
Staatswerdung feiern durfte, eine europäische, eine universelle Idee: die
Idee einer geistigen Gemeinschaft der Völker und der abendländischen
Kulturen!» Das sei, so die Botschaft weiter, «nichts anderes
als der Sieg des Geistes über das Fleisch auf dem harten Boden des
Staatlichen»."
(BBl 1938/II, S. 999)
Mehr: Die Geistige Landesverteidigung in der Schweiz
Quellen / weiterführende Literatur und Links:
- Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (1762),
Buch IV, Kapitel 8.
- Heinz Kleger / Alois Müller (Hg.)
Religion des Bürgers
Zivilreligion in Amerika und Europa
München: Chr. Kaiser Verlag, 1986
- Robert N. Bellah, Civil Religion in America, in:
Daedalus, Journal of the American Academy of Arts and Sciences,
96 (1967), Boston, Massachusetts, p. 1-21
reprint in:
Donald G. Jones and Russell E. Richey (Hg.),
American Civil Religion, Hagerstown/San Francisco/London 1974, p. 21-44
deutsch:
Robert N. Bellah, Zivilreligion in Amerika, in:
Heinz Kleger / Alois Müller (Hg.), Religion des Bürgers, a.a.O., S. 19-41.
en français:
Robert N. Bellah, La religion civile en Amérique, dans:
Archives de Sciences Sociales des Religions 35 (1973), p. 7-22
- Donald G. Jones and Russell E. Richey (Hg.),
American Civil Religion, Hagerstown/San Francisco/London 1974
- Donald G. Jones and Russell E. Richey, The Civil Religion Debate, in:
American Civil Religion, a.a.O., p. 3-18
- Niklas Luhmann, Grundwerte als Zivilreligion, in: Archivo di Filosofia,
Roma 1978, S. 51-71
- Emile Durkheim, Die elementaren Formen des religiösen Lebens (1912),
moderne Ausgabe, deutsche Übersetzung von L. Schmidts, Frankfurt a. M.
1981
- Thomas Hase, Zivilreligion, Religionswissenschaftliche
Überlegungen zu einem theoretischen Konzept am Beispiel der USA,
Würzburg: ERGON Verlag, 2001
Das moderne Konzept der Zivilreligion stammt nicht von Hase, sondern von
Robert N. Bellah (1967), das Buch von Hase zeigt die wesentlichen Züge einer Zivilreligion
aber besonders schön und leicht verständlich auf.
- Gustavo Guizzardi, Der Theismus mit öffentlichen Funktionen.
Katholische Kirche und komplexe Gesellschaft in Italien, in:
Heinz Kleger / Alois Müller (Hg.), Religion des Bürgers, a.a.O., S. 85 - 103
- Jean-Paul Willaime, Zivilreligion nach französischem Muster,
in: Heinz Kleger / Alois Müller (Hg.), Religion des Bürgers, a.a.O., S. 147-174
- Helmut Zenz, Zivilreligion im Internet
Literatur, Links und Zitate zur Zivilreligion (Schwerpunkt: aus theologischer Sicht)
- Isabelle Meier, Mythos Landi:
Ein Blick hinter die Kulissen. Zum
schweizerischen Nationalismus am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, in:
Silvia Ferrari et al., Auf wen schoss Wilhelm Tell? Beiträge zu einer
Ideologiegeschichte der Schweiz, Zürich 1991. (Stark gekürzte Version der
Lizenziatsarbeit von Isabelle Meier: »Die Landi«. Zur Rekonstruktion des
Nationalismus an der Schweizerischen Landesausstellung in Zürich,
Uni Zürich, Zürich 1987)
- J. Mooser, «Die "Geistige Landesverteidigung" in den 1930er Jahren», in SZG 47, 1997, 685-708
© 2003-2004 www.geschichte-schweiz.ch
Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion grösserer
Teile in gedruckter oder elektronischer Form nur mit schriftlicher Einwilligung erlaubt.
Zitate nur mit Quellenangabe (Link). |
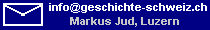
Letztes Update: 6.8.2004 |
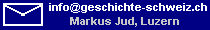
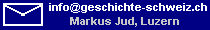
 Religionsdefinition
Religionsdefinition
 Startseite
Startseite